Die Angst vor Krebs ist größer als das reale Risiko
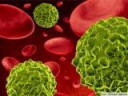 73 Prozent der Deutschen haben Angst, an Krebs zu erkranken. Damit rangiert die Angst vor Krebs, noch vor Demenz oder Schlaganfall, auf Platz eins der Gesundheitsängste der Deutschen. Spezifische Kenntnisse über Krebsarten und ihre Ursachen sind in der Allgemeinbevölkerung hingegen kaum verbreitet. Die persönliche Risikoeinschätzung wird vor allem durch Krankheitserfahrungen im eigenen Umfeld sowie durch dispositionelle Ängstlichkeit beeinflusst, argumentiert Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hoefert (Berlin) im aktuellen Reader „Gesundheitsängste“ und erklärt, warum Medienmeldungen à la Angelina Jolie bestehende Ängste in der Bevölkerung verstärken können.
73 Prozent der Deutschen haben Angst, an Krebs zu erkranken. Damit rangiert die Angst vor Krebs, noch vor Demenz oder Schlaganfall, auf Platz eins der Gesundheitsängste der Deutschen. Spezifische Kenntnisse über Krebsarten und ihre Ursachen sind in der Allgemeinbevölkerung hingegen kaum verbreitet. Die persönliche Risikoeinschätzung wird vor allem durch Krankheitserfahrungen im eigenen Umfeld sowie durch dispositionelle Ängstlichkeit beeinflusst, argumentiert Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hoefert (Berlin) im aktuellen Reader „Gesundheitsängste“ und erklärt, warum Medienmeldungen à la Angelina Jolie bestehende Ängste in der Bevölkerung verstärken können.
„Für mich ist sie eine Heldin“, kommentiert Brad Pitt die Entscheidung seiner Ehefrau Angelina Jolie, sich vorsorglich – aus Angst vor einer Brustkrebserkrankung – beide Brüste amputieren zu lassen. Das Thema Brustkrebs und Brustkrebsprävention steht wieder im Vordergrund der öffentlichen Diskussion. Doch wie realitätsnah ist die in der Bevölkerung weit verbreitete Angst, selbst an Krebs zu erkranken tatsächlich und wodurch werden solche Gesundheitsängste beeinflusst?
Hans-Wolfgang Hoefert, argumentiert, dass bei der Angst vor Krebs – im Unterschied zu eher objekt- oder situationsspezifischen Ängsten – vor allem die Unsicherheit dominiere. Die Angst vor Krebs werde weniger durch frühkindliche Konditionierungsprozesse geprägt, als vielmehr durch das Miterleben von Krebsschicksalen im eigenen Umfeld, eine ängstliche Veranlagung sowie durch Medienmeldungen, die den Eindruck entstehen ließen, Krebsgefahr sei allgegenwärtig. Krebs stelle eine Metapher für die Unsicherheit des eigenen Gesundheitszustands und des gesamten Lebens dar, so der Wissenschaftler.
„Metaphorisch ist Krebs auch insofern zu verstehen, als diese Erkrankung bestimmte Eigenschaften zu haben scheint, die bei anderen Menschen wenig geschätzt werden: Sie ‚lauert‘ im Hintergrund, um dann irgendwann ‚hervorzubrechen‘, ist ‚böswillig‘ und ‚aggressiv‘, indem sie zerstört und nicht nur die physischen, sondern auch die sozialen Lebensgrundlagen bedroht“, so Hoefert. Zudem stehe Krebs auch für Hilflosigkeit und soziale Isolation. „Das Schicksal anderer Menschen zeigt, wie jemand seine angestammten sozialen Rollen als Berufstätiger, als Vater oder Mutter verlieren und zu einem ‚sozialen Nichts‘ degenerieren kann“. Es falle dem Laien daher schwer, Krebs lediglich als „regelwidriges Zellwachstum“ zu betrachten.
„[Es] muss festgehalten werden, dass Krebserkrankungen erst an dritter Stelle – hinter Herz-Kreislauferkrankungen und Infektionskrankheiten – unter den Todesursachen rangieren. Zweitens ist die Krebssterberate in der EU im Vergleich zwischen 2007 und 2011 rückläufig. […] Ein ähnlicher Trend zeichnet sich für die USA ab.“ – Warum dann aber die weit verbreitete Angst?
Die „subjektive“ Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, folgt oft nicht allein objektiven Daten, erklärt Hoefert. So könne die Aussage „eine von 100“ eine hohe Beunruhigung veranlassen, da man sich als „der eine Fall“ betrachtet. Dazu komme, dass die Fähigkeit mit Prozentzahlen korrekt umzugehen, auch bei Personen mit höherem Bildungsniveau oft nicht gegeben ist. Zudem tendierten viele Menschen dazu, bei Verdacht auf ein eigenes Risiko Daten zu sammeln (z.B. im Internet), die zu einer weiteren Verunsicherung hinsichtlich des tatsächlichen Krebsrisikos führen.
Hoefert zufolge deuteten einige neuere Studien darauf hin, dass die subjektive Risikoeinschätzung stark durch emotionale Faktoren geprägt werde. So zeigten Untersuchungen, dass Personen mit hoher Krebsangst verstärkt dazu tendierten, neutrale, mehrdeutige Stimuli in negativer Weise zu interpretieren. Auch wiesen die betreffenden Personen ein höheres allgemeines Angstniveau auf.
„Emotionale Faktoren scheinen ‚existenzieller‘ zu sein als kognitive“, folgert Hoefert auf Basis der bestehenden Befundlage.
Der Sammelband „Gesundheitsängste“ bietet in Einzelbeiträgen einen Überblick unter den Gesichtspunkten kollektive Verbreitung, Umweltrisiken, organspezifische und systemische Erkrankungen, Ernährungsrisiken, Verletzungen, Medieneinflüsse, psychische Hintergründe. Erhält die Angst einen Krankheitswert, wird eine Behandlung notwendig; Maria Gropalis und Gaby Bleichardt berichten in einem abschließenden Kapitel über die kognitiv-behaviorale Psychotherapie bei Gesundheitsängsten und Hypochondrie.
Quelle: openPR
bisher keine Kommentare

Comments links could be nofollow free.




